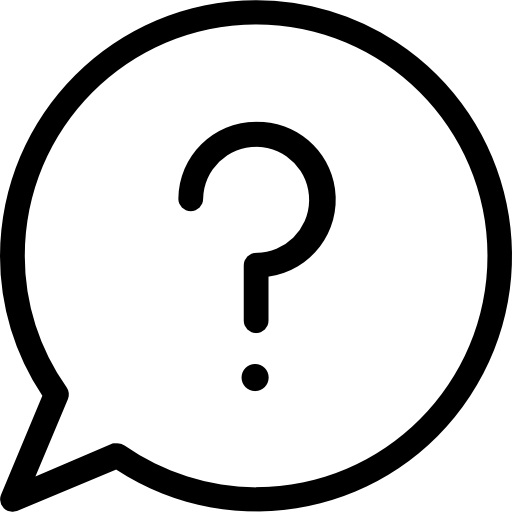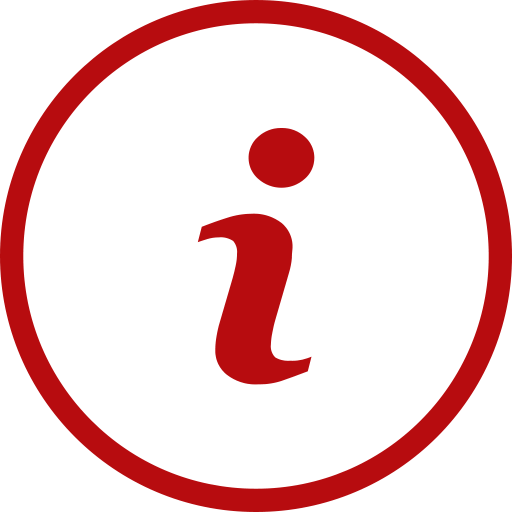Meine Dialyse.
Soziales & Rechtliches
Wenn eine chronische Nierenerkrankung diagnostiziert wird, ist das für Sie und Ihr nahes Umfeld ein großer Einschnitt im Leben. Die Diagnose bringt im Krankheitsverlauf nicht nur medizinische Maßnahmen und emotionale Herausforderungen mit sich, sie wird oft auch von sozialrechtlichen Fragen begleitet. Hier möchten wir Sie gerne unterstützen!
Auf dieser Seite erhalten Sie nützliche Informationen rund um die sozialen Themen, die sich im Rahmen der chronischen Nierenerkrankung ergeben können.
Alle Auskünfte sollen Ihnen als Hilfestellung dienen. Sie ersetzen nicht das individuelle Gespräch mit Fachleuten und stellen keine Rechtsberatung dar.
Mein Grad der Behinderung und Nachteilsausgleiche
Als chronisch nierenkranker Mensch können Sie beim zuständigen Versorgungsamt einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung stellen. Die Anträge erhalten Sie meist auch bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung oder online auf der Seite www.einfach-teilhaben.de
(→ Schwerbehinderung → Ratgeber „Wie beantrage ich einen Schwerbehindertenausweis“ → Punkt 3 „Wählen Sie den richtigen Antrag“).
Aufgrund Ihrer Behinderung können Sie die sogenannten Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen. Das sind Unterstützungsmaßnahmen, um die Nachteile oder Mehrkosten, die durch Behinderung verursacht werden, auszugleichen.
Alle Nachteilsausgleiche sollen Sie in Ihrer besonderen Situation unterstützen! Hierbei handelt es sich um Ausgleiche für die Nachteile, die Ihnen als chronisch nierenkranker Mensch entstehen.
Welchen Grad der Behinderung erhalte ich?
Bei den Nierenerkrankungen werden 3 Stadien unterschieden. Die Phase vor der Dialyse (Prädialyse), die Phase des Lebens mit einem transplantierten Organ.
Prädialyse
Nierenfunktionseinschränkung leichten Grades:
GdB von 20 – 30 können bewilligt werden, wenn
- Serumkreatininwerte unter 2 mg/dl [Kreatininclearance ca. 35 – 50 ml/min] liegen,
- Allgemeinbefinden nicht oder nicht wesentlich reduziert ist und
- keine Einschränkung der Leistungsfähigkeit vorliegt.
GdB von 40 kann bewilligt werden, wenn
- Serumkreatininwerte andauernd zwischen 4 und 8 mg/dl erhöht
- Allgemeinbefinden wenig reduziert,
- leichte Einschränkung der Leistungsfähigkeit.
Nierenfunktionseinschränkung mittleren Grades:
GdB von 50 – 70 können bewilligt werden, wenn
- Serumkreatininwerte andauernd zwischen 4 und 8 mg/dl erhöht
- Allgemeinbefinden stärker beeinträchtigt,
- mäßige Einschränkung der Leistungsfähigkeit
Nierenfunktionseinschränkung schweren Grades:
GdB von 80 – 100 können bewilligt werden, wenn
- Serumkreatininwerte dauernd über 8 mg/dl,
- Allgemeinbefinden stark gestört,
- starke Einschränkung der Leistungsfähigkeit,
- bei Kindern keine normalen Schulleistungen mehr.
Dialyse
GdB von 100 bei Notwendigkeit der Dauerbehandlung mit einem Blutreinigungsverfahren (Hämodialyse oder Peritonealdialyse).
Transplantation
Merkzeichen
| Merkzeichen | Bedeutung |
|---|---|
| G | Gehbehindert |
| aG | Außergewöhnlich gehbehindert |
| B | Berechtigung für eine ständige Begleitung |
| Gl | Gehörlosigkeit |
| Bl | Blind |
| H | Hilflos |
| RF | Rundfunkbeitragsbefreiung oder -ermäßigung |
| TBl | Taubblind |
Nachteilsausgleiche
Zum Ausgleich Ihrer behinderungsbedingten Nachteile oder der Mehrkosten können Sie die sogenannten Nachteilsausgleiche in Anspruche nehmen.
Hierbei handelt es sich beispielsweise um:
- Steuervergünstigungen
- Sonderrechte beim Parken
- berufliche Nachteilsausgleiche, wie zusätzliche Urlaubstage
- Ermäßigungen bei öffentlichen Veranstaltungen
- früherer Eintritt in die Altersrente
- Vergünstigungen oder Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr
- und vieles mehr
Detaillierte Aufstellungen zu den Nachteilsausgleichen und den konkreten Voraussetzungen, die jeweils vorliegen müssen, finden Sie hier:
Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen
Im Folgenden stellen wir Ihnen wichtige Regelungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung dar, die für Sie von Bedeutung sein können. Die private Krankenversicherung kann im Rahmen dieser Webseite nicht berücksichtigt werden, da sich Leistungspflicht und Leistungsumfang durch den individuellen Versicherungsvertrag bestimmen.
Zuzahlungen
Als gesetzlich krankenversicherter Mensch müssen Sie Zuzahlungen leisten, auch wenn Sie chronisch krank sind oder von Bürgergeld und Regelungen zur Befreiung leben. Zuzahlungen fallen z. B. für Medikamente, Heilmittel und Krankenhausaufenthalte an.
Die detaillierten Regelungen zu den Zuzahlungen finden Sie hier:
BundesgesundheitsministeriumWenn Sie von den Zuzahlungen befreit sind, dann ist Ihre ganze einberechnete Familie befreit, auch wenn Sie in unterschiedlichen gesetzlichen Krankenkassen versichert sind.
Belastungsgrenzen und Chronikerregelung
Für die Zuzahlungen gibt es Belastungsobergrenzen. Bei der Berechnung Ihrer individuellen Grenze wird Ihr (Familien-) Jahresbruttoeinkommen, bereinigt um verschiedene Freibeträge, herangezogen.
Aktuell gelten folgende Grenzwerte:
- 2% des (Familien-) Jahresbruttoeinkommens für alle Versicherten
- 1% des (Familien-) Jahresbruttoeinkommens für schwerwiegend chronisch kranke Menschen (Chroniker-Regelung)
Sie gelten als chronisch krank, wenn Sie wegen derselben Erkrankung ein Jahr lang mindestens einmal pro Quartal ärztlich behandelt wurden und außerdem eines der folgenden Merkmale erfüllt ist:
- Es liegt eine Pflegebedürftigkeit des Grades 3, 4, oder 5 vor.
- Es liegt ein Grad der Behinderung oder eine Erwerbsminderung von mindestens 60 Prozent vor.
- Es ist eine kontinuierliche medizinische Versorgung notwendig, ohne die nach ärztlicher Einschätzung schwerwiegende Beeinträchtigungen zu erwarten sind (→ ärztliche Bescheinigung)
Viele Krankenkassen bieten ihren Versicherten eine Einmalzahlung der Zuzahlungen zu Beginn des Jahres an. Ihre Krankenkasse rechnet Ihnen die Höhe ihrer jährlichen Zuzahlung aus und Sie überweisen dann den Gesamtbetrag in einer Summe. Damit sind Sie für den Rest des Jahres befreit und ersparen sich z.B. das Sammeln der Quittungen.
Aber Achtung!
Bei dieser Regelung gibt es keine Rückzahlung. Wenn sich Ihre Situation ändert und Sie unter Umständen die 1% Hürde nicht erreichen, erstatten die Krankenkassen in diesem Fall kein Geld zurück.
Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung (Dialysefahrten)
Fahrtkosten zu ambulanten Behandlungen werden nur noch in Ausnahmefällen übernommen. Ihre Dialysefahrten stellen eine solche Ausnahme dar und können weiterhin verordnet werden, wenn sie medizinisch unerlässlich sind. Hin- und Rückfahrt werden dabei getrennt beurteilt.
Für Fahrten zu allen anderen Behandlungen müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein.
Die Vorabgenehmigungspflicht für ambulante Fahrten entfällt, wenn ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen aG oder H vorliegt oder wenn eine Einstufung in den Pflegegrad 4 oder 5 oder bei dauerhafter Beeinträchtigung der Mobilität in Pflegegrad 3.
Fahrtkosten nach Nierentransplantation
Für die ambulanten Nachsorgetermine im Transplantationszentrum werden die Fahrtkosten nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse für die ersten drei Monate übernommen (§ 60 SGB V in Verbindung mit § 115a Absatz 2 Satz 2 SGB V). Im entsprechenden Gesetz steht auch, dass diese Frist in begründeten Einzelfällen verlängert werden kann (§ 115 a Absatz 2 Satz 3 SGB V).
Handelt es sich um stationäre Nachsorgetermine, werden die Kosten von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet.
Krankengeld
Wenn Sie krank werden, zahlt Ihr Arbeitgeber meist für 6 Wochen wie gewohnt Ihren Lohn weiter. Dauert Ihre Erkrankung länger, übernimmt die Krankenkasse und zahlt Krankengeld. Das Krankengeld beträgt in der Regel 70% des Bruttolohns (gekappt nach der „Beitragsbemessungsgrenze“), aber nicht mehr als 90% des Nettolohns.
Allerdings ist das Krankengeld zeitlich begrenzt. Es wird nicht länger als 78 Wochen in einem Zeitraum von 3 Jahren wegen der gleichen Erkrankung gezahlt. Die Zeiten der Lohn- oder Gehaltsfortzahlung werden hierbei angerechnet.
Die Krankenkasse ist nicht verpflichtet, 78 Wochen lang Krankengeld zu zahlen. Wenn sie davon ausgeht, dass Ihre Arbeitsunfähigkeit in eine Erwerbsminderung übergehen wird, kann sie Sie auffordern, einen Reha-Antrag bei der Rentenversicherung (DRV) zu stellen.
Sie müssen dieser Aufforderung innerhalb von 10 Wochen nachkommen, sonst stellt die Krankenkasse ihre Zahlungen ein. Ein Reha-Antrag wird automatisch in einen Rentenantrag umgedeutet, wenn Ihre Erwerbsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden kann.
Dialyse während der Arbeitszeit
Können Sie an den Dialysetagen nicht arbeiten, besteht bei bescheinigter Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld.
Diese Tage werden aber auf Ihren Krankengeldanspruch von insgesamt 78 Wochen in einem Zeitraum von 3 Jahren angerechnet.
Wird nur ein Teil Ihres Arbeitstages für die Dialyse benötigt, gibt es die Möglichkeit, eine Art Ersatz des Verdienstausfalls im Sinne von „ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation“ zu beantragen. Hierzu sollten Sie auf jeden Fall ein klärendes Gespräch mit Ihrer Krankenkasse suchen, denn die Handhabung ist teilweise unterschiedlich. Grundlage für diese Regelung ist eine Empfehlung des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkasse. Diese sieht vor, dem Arbeitgeber das auf die ausgefallene tägliche Arbeitszeit entfallene Bruttoarbeitsentgelt, zuzüglich der Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu erstatten.
Leistungen im Rahmen der Nierenlebendspende
In der Regel werden die Kosten, die im Rahmen einer Nierenlebendspende anfallen, von der Krankenkasse der organempfangenden Person übernommen.
27 (1a) SGB V legt die medizinischen Leistungen an die spendende Person fest.
Zur Krankenbehandlung gehören
- die Voruntersuchungen
- der stationäre Aufenthalt
- die Nachsorge
- die Übernahme der Fahrtkosten zu all diesen Terminen
- der Verdienstausfall aufgrund dieser Termine
- Reha-Maßnahmen
Als Lebendspenderin oder Lebendspender müssen Sie keine Zuzahlungen leisten!
Sollte die spendende Person aufgrund der Lebendorganspende einen Gesundheitsschaden erleiden, besteht Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung (§12a SGB VII).
Bei der Lebendnierenspende an eine privat krankenversicherte Person, greift die Selbstverpflichtungserklärung der Privaten Krankenversicherungsunternehmen. Nähere Informationen erhalten Sie hier
privat-patienten.deMedizinische Rehabilitation
Eine medizinische Rehabilitation (umgangssprachlich „Kur“) können Sie antreten, wenn Ihre behandelnde Ärztin bzw. Ihr Arzt diese für notwendig hält und Ihnen verordnet und diese bewilligt wird. Der vollständige Antrag auf Rehabilitation wird bei der Krankenversicherung gestellt. Der Medizinische Dienst stellt daraufhin die Notwendigkeit fest und bewilligt ggf. die Maßnahme. Diese geht normalerweise über 3 Wochen und kann, bei medizinischer Notwendigkeit, alle 4 Jahre beantragt werden. Es gibt unterschiedliche Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation, z. B. die Anschlussheilbehandlung oder eine geriatrische Rehabilitation.
Auch die Rentenversicherung kann für eine Reha zuständig sein. Der erstangegangene Träger muss binnen zwei Wochen über die Zuständigkeit entscheiden.
Palliative Versorgung
Die Erwerbsminderungsrente
Manchmal bringt die Erkrankung es mit sich, dass Sie Ihren Beruf nicht mehr oder nur noch teilweise ausüben können. Für diesen Fall besteht die Möglichkeit, dass Sie bei der Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) beantragen können, wenn Sie die entsprechenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Die Rentenbewilligung richtet sich danach, ob Sie grundsätzlich einer leichten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch nachgehen könnten. Entscheidend ist nicht, ob Sie speziell Ihren erlernten Beruf noch ausüben können (Ausnahme: andere Richtlinien gelten für Menschen, die vor dem 02.01.1961 geboren sind).
Die Feststellung der Leistungsfähigkeit erfolgt in der Regel durch ein medizinisches Gutachten, das die Rentenversicherung kostenfrei für Sie einholt.
Neben den gesundheitlichen Gründen müssen zusätzliche versicherungsrechtliche Voraussetzungen vorliegen, damit Sie eine EM-Rente erhalten.
- Sie müssen 5 Jahre Mindestversicherungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung aufweisen und
- Sie müssen mindestens 3 Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten 5 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung gezahlt haben.
EM-Renten werden in der Regel auf Zeit gewährt: der längste Bewilligungszeitraum beträgt 3 Jahre. Danach erfolgt auf Antrag eine erneute Überprüfung. EM-Renten werden längstens bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze und damit bis zur Altersrente gezahlt. Wann genau Sie in Altersrente gehen können, erfahren Sie von der Deutschen Rentenversicherung.
Welche existenzsichernde Leistungen sind möglich?
Krankheitsbedingte Lebenssituationen können immer auch dazu führen, dass Sie auf unterhaltssichernde Maßnahmen angewiesen sind. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Sonderform des Arbeitslosengeldes – speziell für kranke Menschen – und die verschiedenen Grundsicherungsleistungen vor. Auch Wohngeld und der Kinderzuschlag werden dargestellt.
Nach dem Krankengeld und vor der Rente – die „Nahtlosigkeitsregelung“
Wenn Sie sehr lange krank sind, kann es passieren, dass Ihr Anspruch auf Krankengeld aufgebraucht ist. Wenn dieses abläuft und Sie noch keinen Antrag auf Rente gestellt haben oder diese noch nicht bewilligt wurde, dann können Sie eventuell bei der Arbeitsagentur das Arbeitslosengeld trotz Minderung der Leistungsfähigkeit (§ 145 SGB III) beantragen. Sie müssen hierfür aus Vorversicherungszeiten in der Arbeitslosenversicherung einen formalen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben.
Diese Nahtlosigkeitsregelung wurde geschaffen, um sicherzustellen, dass Menschen nicht aus den sozialen Sicherungssystemen herausfallen. Die Arbeitsagentur wird Sie im Rahmen des Verfahrens auffordern, unverzüglich einen Antrag auf medizinische Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu stellen. Dieser Aufforderung müssen Sie nachkommen.
Grundsicherungsleistungen
Krankheit und andere schwierige Umstände im Leben können dazu führen, dass Sie Ihren Lebensunterhalt nicht mehr aus eigenen Mitteln bestreiten können. Dies ist eine sehr belastende Situation. Hierfür gibt es drei Leistungsarten (Bürgergeld, Sozialhilfe und Grundsicherung), die einspringen, wenn alle anderen Sicherungssysteme nicht oder nicht ausreichend greifen.
Welche der drei Leistungsarten Ihnen zusteht, hängt von Ihrem Alter und Ihrer Erwerbsfähigkeit ab. Es gibt folgende Leistungen:
- Bürgergeld
Bürgergeld erhalten Sie vom Jobcenter. Für den Bezug müssen Sie mindestens 3 bis unter 6 Stunden täglich arbeiten können. Dies trifft auch zu, wenn Sie eine halbe Erwerbsminderungsrente erhalten, da dann festgestellt wurde, dass Sie mindestens 3 Stunden täglich arbeiten können.
- Sozialhilfe
Sozialhilfe erhalten Sie vom Sozialamt. Diese Leistung wird Ihnen gewährt, wenn Sie eine befristete volle Erwerbsminderungsrente beziehen, die in der Höhe nicht zur Bewältigung des Lebensunterhalts ausreicht oder aber, wenn keine Ansprüche auf Einkommensersatzleistungen bestehen.
- Grundsicherung
Grundsicherung beziehen Sie ebenfalls vom Sozialamt. Diese Leistung erhalten Sie, wenn Sie Altersrentnerin bzw. Altersrentner sind oder eine unbefristete Erwerbsminderungsrente erhalten.
Die laufenden Regelleistungen gestalten sich für die drei Leistungsarten gleich.
Ein alleinstehender Erwachsener erhält folgende Leistungen (Stand 05/2025):
- 563 Euro (Regelsatz)
- (angemessene) Kosten der Unterkunft
- Heizung
Zudem können Sie Einmalleistungen, z. B. für Erstausstattungen mit Kleidung, und Mehrbedarfe beantragen, z. B. für Alleinerziehende, bei krankheitsbedingter kostenaufwändiger Ernährung oder wenn Sie Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten. Auch das Merkzeichen G zieht einen Mehrbedarf nach sich.
Gerade ältere Menschen haben häufig Sorge, dass ihre Kinder herangezogen werden, wenn sie eine Grundsicherungsleistung beantragen. Diese Angst muss nicht berechtigt sein. Bei der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung wird ein Kind erst zum Unterhalt herangezogen, wenn es über ein Jahreseinkommen von über 100.000 EUR verfügt.
Wohngeld und Kinderzuschlag
Liegen Sie mit Ihren Einkünften knapp über den Grundsicherungsleistungen, können Sie prüfen lassen, ob eventuell Wohngeld oder der Kinderzuschlag für Sie in Frage kommt.
Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten, das entweder als Zuschuss zur Miete oder als Lastenzuschuss für Immobilienbesitzerinnen und Besitzer gewährt wird.
Schwerbehinderten Menschen wird unter Umständen ein Freibetrag von aktuell 1.800 Euro eingeräumt. Dies gilt, wenn Sie
- einen Grad der Behinderung von 100 zugesprochen bekommen haben oder
- einen Grad der Behinderung von 50 erhalten haben und gleichzeitig Pflegebedürftigkeit in häuslicher/teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege vorliegt.
Sollte ihr Einkommen nicht für die ganze Familie reichen, können Eltern zusätzlich zum Kindergeld den Kinderzuschlag beantragen. Der Antrag hierauf muss gesondert bei der Familienkasse gestellt werden.
Diese Leistung können Sie bei Bedarf neben dem Wohngeld beantragen.
Hilfreich ist im Vorfeld die Führung eines Pflegetagebuchs. Da man sich an manche Einschränkungen im Lauf der Zeit gewöhnt, sollten Sie im Vorfeld ca. 2 Wochen lang aufschreiben, wann Sie im Tagesverlauf Unterstützung und Hilfe benötigen. Sind Sie dialysepflichtig? Dann unterscheiden Sie bitte zwischen Dialysetagen und dialysefreien Tagen, da dies in der Regel einen Unterschied im Unterstützungsbedarf macht.
Empfehlenswert ist, dass beim Hausbesuch der Gutachterin oder des Gutachters die Person anwesend ist, die Sie unterstützt, da dann der Alltag realistisch dargestellt werden kann.
Für die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit sind sechs Bereiche, auch Module genannt, maßgeblich.
- Mobilität (z.B. Positionswechsel im Bett, Fortbewegung innerhalb des Wohnbereichs)
- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (z.B. örtliche und zeitliche Orientierung, Mitteilen von elementaren Bedürfnissen)
- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (z.B. Ängste, Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage)
- Selbstversorgung (vor allem Körperpflege, Nahrungsmittelaufnahme, Toilettengang)
- Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen (z.B. Medikamenteneinnahme, Einhalten einer Diät, Arztbesuche)
- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (z.B. Gestaltung des Tagesablaufs)
Beeinträchtigungen in der Haushaltsführung und den außerhäuslichen Aktivitäten sollen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Erfassung dient der Pflegeplanung und zur Feststellung des Reha- und Präventionsbedarfs.
Nach der Begutachtung schickt die Kasse Ihnen den Bescheid. Sie teilt Ihnen darin mit, ob sie Ihrem Antrag nachkommt bzw. welcher Pflegegrad Ihnen gewährt wird. Das Gutachten wird beigefügt. Wenn Sie mit dem Inhalt des Bescheides der Pflegekasse nicht einverstanden sind, können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Zur Fristwahrung reicht der Eingang des Widerspruchs ohne Begründung. Diese können Sie nachreichen.
- Pflegetagebuch
- Den aktuellen Medikamentenplan
- Aktuelle Krankenhaus- und Arztberichte
- Bescheide und Gutachten (z.B. Schwerbehindertenbescheid)
- Liste über alle Hilfsmittel (z.B. Rollator oder Hörgerät) und alle Pflegehilfsmittel (z.B. Hausnotruf oder Pflegebett)
- Liste über regelmäßige Behandlungen (z.B. Krankengymnastik) und Arztbesuche/Untersuchungen
- Aktuelle Pflegedokumentation
Pflegebedürftigkeit – Pflegegrade
Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeiten aufweisen und deshalb Hilfe durch andere bedürfen. Dieser Zustand muss für voraussichtlich mindestens 6 Monate bestehen. Die Leistungen bestimmen sich durch den jeweils zuerkannten Pflegegrad, der mit Hilfe eines Punktsystems ermittelt wird. Die Feststellung eines bestimmten Pflegegrades erfolgt gemessen an der Selbstständigkeit einer Person.
Leistungen der Pflegeversicherung
Vorsorgedokumente
Jeder Mensch kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln kann. Sicherlich werden Ihnen Ihre Angehörigen oder andere Ihnen nahestehende Menschen im Ernstfall zur Seite stehen. Wenn aber rechtsverbindliche Entscheidungen getroffen werden müssen, haben Sie als erwachsener Mensch langfristig keinen gesetzlichen Vertreter.
Um vorzusorgen, können Sie verschiedene Dokumente abfassen, mit denen Ihr Wille festgehalten wird, sodass dieser auch in Zeiten berücksichtigt wird, in denen Sie sich nicht äußern können.
Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung können Sie dokumentieren, wie Sie behandelt werden möchten, wenn Sie selbst nicht mehr entscheiden können. Eine Person, die die niedergelegten Wünsche vertritt, sollte von Ihnen zusätzlich benannt werden. Auf diese Weise können Sie Einfluss auf eine spätere ärztliche Behandlung nehmen und Ihr Selbstbestimmungsrecht wahren. Formal wird empfohlen, die Patientenverfügung schriftlich zu verfassen und eigenhändig zu unterschreiben. Außerdem sollte eine Zeugin oder ein Zeuge unterschreiben. Erneuern Sie die Unterschriften alle ein bis zwei Jahre, um darzustellen, dass Sie weiterhin am Inhalt festhalten.
Vorsorgevollmacht
Mit der Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie eine Ihnen nahestehende Person, alle oder bestimmte Aufgaben zu übernehmen, wenn Sie entscheidungs- oder handlungsunfähig sind.
Fügen Sie eine Vollmacht Ihrer Bank bei, da die meisten Kreditinstitute nur ihre eigenen Vordrucke akzeptieren.
Betreuungsverfügung
Die Betreuungsverfügung kommt zum Tragen, wenn ein Gericht darüber entscheidet, wen es als gesetzlich betreuende Person für Sie einsetzt. Sie können in der Verfügung darlegen, wen Sie sich vorstellen können und wer auf keinen Fall eingesetzt werden soll.
Reise und Dialyse
Die Dialyse muss auch während der Urlaubszeit durchgeführt werden. Deshalb sollte die Reise sorgfältig geplant und mit der Krankenkasse die Kostenfrage für die Behandlung und die Fahrtkosten vor Ort geklärt werden. Vor Antritt Ihrer Reise sollten Sie Details und Termine mit dem Feriendialysezentrum absprechen. Nur so ist sichergestellt, dass alles Notwendige vorhanden und ein entsprechender Platz frei ist.
Feriendialyse in Deutschland
Wenn Sie in Deutschland reisen wollen, stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen. Ihre Dialysebehandlung wird dann – soweit durchführbar – in ein Dialysezentrum Ihrer Wahl verlegt.
Privatversicherte Menschen sollten vorher mit ihrer Versicherung das genaue Vorgehen abklären.
Gesetzlich Versicherte benötigen für die Behandlung ihre Krankenversicherungskarte (EHIC) und einen Überweisungsschein ihrer Nephrologin bzw. ihres Nephrologen zu Hause. Dennoch sollten Sie – besonders, wenn Sie das erste Mal reisen – frühzeitig alle Kosten- und auch Abrechnungsfragen sowohl mit Ihrer Krankenversicherung als auch mit dem Dialysezentrum vor Ort geklärt haben. Denken Sie auch an die Abklärung der Fahrtkosten.
Feriendialyse im Ausland
Sind Sie gesetzlich krankenversichert? Dann muss vor der Reise eine genaue Klärung mit der Kasse erfolgen, die die Behandlung im Ausland genehmigt. Das Kostenübernahmeverfahren hängt vom jeweiligen Urlaubsland und von der Kasse ab. Manche Krankenkassen haben Verträge mit Zentren im Ausland abgeschlossen. Wenn nicht, müssen Sie im Regelfall die Kosten vorstrecken und dann bei Ihrer Kasse Erstattung verlangen. Sie erhalten für das Zielland eine Bescheinigung über Ihre Versicherung in Deutschland und legen diese im Ausland vor. Zugleich müssen Sie vor Ort Ihre Versicherungskarte (EHIC) vorlegen.
Wenn Sie privatversichert sind, müssen auch Sie bei Auslandsreisen frühzeitig das genaue Vorgehen mit ihrer Krankenversicherung abstimmen und sich die Behandlung im Ausland genehmigen lassen. Das Verfahren und die Abwicklung variiert von Versicherer zu Versicherer.
Auch für Reisen ins Ausland gilt: Klären Sie die Fahrtkosten zur Dialyse.
Welche medizinischen Informationen benötige ich?
Das Dialysezentrum zu Hause versendet in den meisten Fällen einen Arztbrief mit allen wichtigen Angaben an das Feriendialysezentrum. Zusätzlich sollten Sie eine Kopie dieser Unterlagen (Überweisungsschein, Angaben zu Medikamenten, Laborwerten usw.) auf der Reise mit sich führen, evtl. zusätzlich in Fremdsprachen! So sind diese auch dann verfügbar, wenn die Post nicht (rechtzeitig) ankommt oder auf der Reise ein Stopp eingelegt werden muss.
Welche Feriendialyseorte gibt es?
Informationen über Feriendialyseorte können Sie im Heimat-Dialysezentrum erfragen. Auch spezielle Zeitschriften und Interessenverbände halten entsprechende Informationen bereit. So gibt es beispielsweise auch Angebote für Kreuzfahrten.
Bekomme ich einen Zuschuss bei Urlaubsreisen?
Der Hilfsfonds Dialyseferien e. V. gewährt bei entsprechend niedrigem Einkommen einen Urlaubszuschuss.
Wer hilft mir weiter?
Selbsthilfe
Informations- und Beratungsangebote
Verband Deutsche Nierenzentren e.V. und Bundesverband Niere e.V.
Mittwochs 16.00 – 18.00 Uhr
0800 248 48 48
Umfassende Beratung in sozialen Fragen
Suchmaschine: Allgemeine Sozialberatung + Städtenamen
Information und Beratung rund um die stationäre Rehabilitation
0341 870 59590
info@arbeitskreis-gesundheit.de
www.akges.de
Bürgertelefone
| Rente | 030 221 911 001 |
| Unfallversicherung | 030 221 911 002 |
| Arbeitslosenversicherung / Bürgergeld / Bildungspaket | 030 221 911 003 |
| Arbeitsrecht | 030 221 911 004 |
| Teilzeit und Minijobs | 030 221 911 005 |
| Informationen für Menschen mit Behinderung | 030 221 911 006 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 030 221 911 008 |
| Krankenversicherung | 030 340 606 601 |
| Pflegeversicherung | 030 340 606 602 |
Unterstützung in Krisensituationen
Suchmaschine: Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen + Städtenamen
Beratung zu Rehabilitation und Teilhabe
fachstelle@teilhabeberatung.de
www.teihabeberatung.de
Unterstützung und Beratung für gleichgestellte und schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
www.integrationsaemter.de
Kostenlose, wohnortnahe Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung
Suchmaschine: Pflegestützpunkt + Städtenamen
Sozialverbände
Beratung und Informationen in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen für gesetzlich, privat oder auch nicht versicherte Menschen.
0800 011 77 22
www.patientenberatung.de
030 301 010 00
info@wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de
www.wegweiser.hospiz-palliativmedizin.de
Inhaltlicher Stand Mai 2025
Bitte beachten Sie, dass diese Inhalte sehr ordentlich recherchiert wurden, aber keinen Anspruch auf eine umfassende Darstellung sämtlicher Details erheben. Auch unterliegen die dargestellten gesetzlichen Regelungen etwaigen Änderungen. Die juristische Beratung im Einzelfall können diese Inhalte auf keinen Fall ersetzen.